WARFARE ist extrem sensorisches Kino. Es wird viel geschossen, aber eben nie stumpf wie in einem Actionfilm. Das Sounddesign stellt sicher, dass jede einzelne abgegebene Kugel Gewicht hat. Jeder Schuss rollt gleich einer Welle durch den Kinosaal, überwältigt den Hörnerv, übersetzt sich in Vibration und nimmt so den gesamten Körper in Beschlag.
WARFARE ist Körperkino, das auf allen Sinnesebenen Mark und Bein durchdringt. Dazu gehören auch drastische Bilder von verletzten und getöteten Soldaten. Eigentlich bin ich der Meinung, dass diese Art der Inszenierung des Krieges mittlerweile ausgedient hat und wir andere Bilder suchen müssen. Aber Alex Garland und Ray Mendoza haben hier noch einmal einen produktiven Weg gefunden, mit diesen Abbildern unvorstellbaren Schmerzes zu arbeiten.
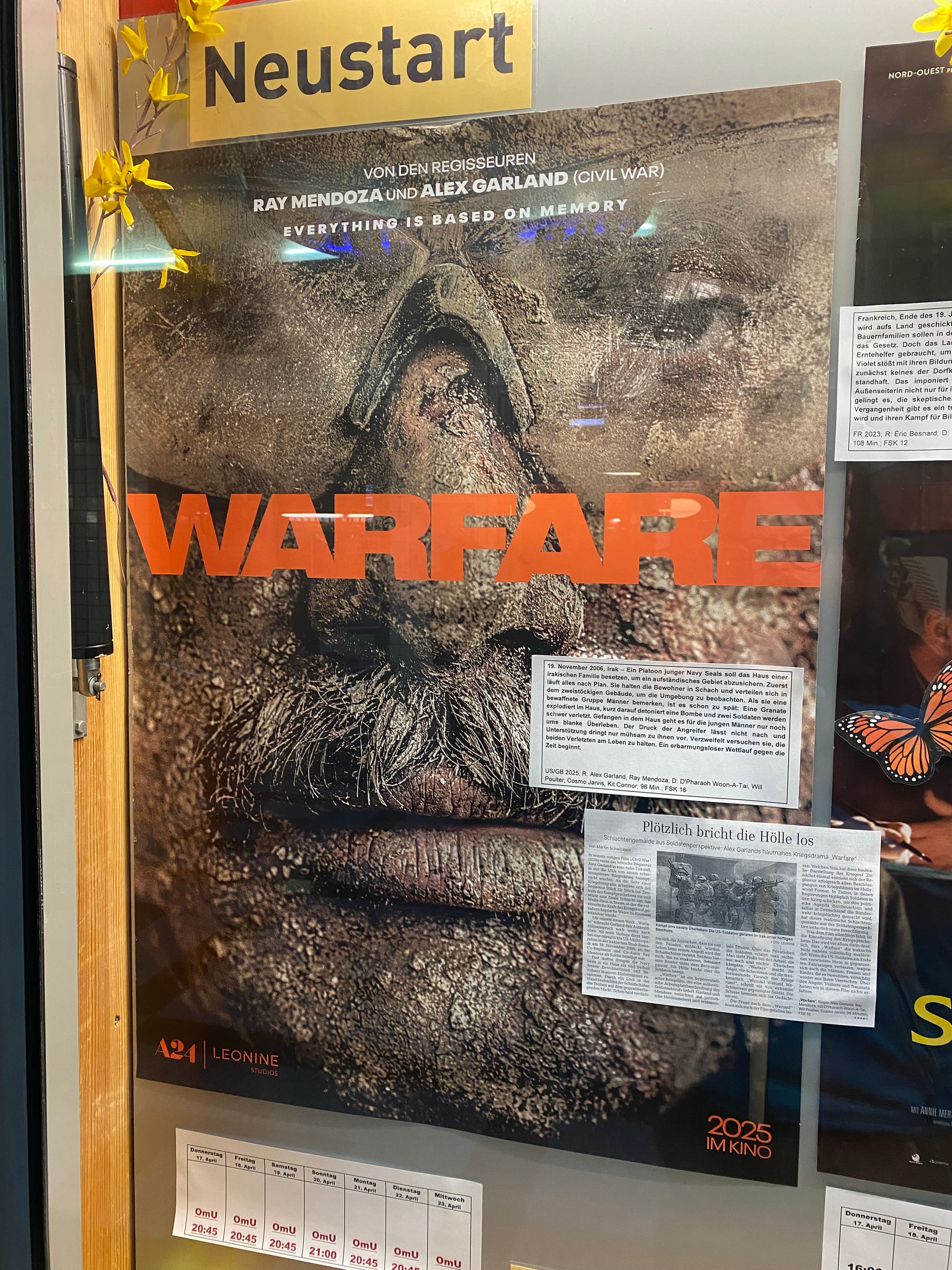
Wir sehen eine Einheit von US-Navy-Seals, die wie einem Team von Medizinern in der Unfallchirurgie gleich agiert: ultra präzise, klar in der Kommunikation und mit nahezu stoischer Redundanz Abläufe absichernd. So versuchen sie auch, die schwerverletzten Kameraden am Leben zu erhalten. Nur bricht an dieser Stelle die Realität der Besetzung des Irak herein und offenbart die Perversion dieser Präzision, die letztlich nicht auf den Erhalt, sondern das Beenden von Leben hin bis zum Erbrechen trainiert wird.
Garland und Mendoza zeigen die Notfall-OP an einem Patienten, den man zuvor selbst vorsätzlich lebensgefährlich verletzt hat – eine selbsterfüllende Prophezeiung.
(P.S.: Ich möchte das nicht als Teil des Films werten, da es erst nach der finalen Schwarzblende als Teil des Abspanns passiert. Aber: Den Soldaten dieser Navy-Seal-Einheiten in einer Texttafel dafür zu danken, dass sie immer zur Stelle sind, wenn sie gerufen werden, und dabei den völkerrechtswidrigen Kontext und die Opfer dieses Krieges außen vor zu lassen, ist eine unglaubliche menschenverachtende Geschmacklosigkeit.)
★★★★☆






Member discussion